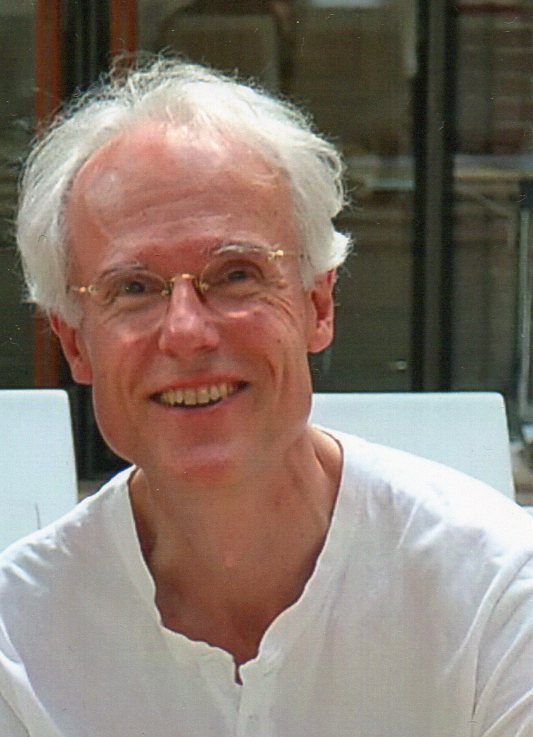
Meine musikalische Heimat ist das Wien der alten und neuen Wiener Schule: beredte Musik, unerhört, aus einem Geist von Negation und Utopie.
Er wehte auch in der Musikhochschule in Hannover, wo ich zu studieren begann. Prägende Einflüsse verdanke ich dort dem Theorieunterricht bei Helmut Lachenmann und der Pianistin Erika Haase, einer Schülerin Eduard Steuermanns. Beide bestärkten mich darin, meine Studien bei noch lebenden Schülern Schoenbergs fortzusetzen. Dies führte mich unweigerlich in die U.S.A., das Exil-Land jenes Geistes. Ihm hinter den Noten aufzuspüren lehrten mich Rudolf Kolisch und Eugene Lehner, der Bratscher des Kolisch-Quartetts; das Handwerk des Komponierens eröffneten mir Felix Greissle, Leonard Stein und, aus dritter Schoenberg-Hand, ein gänzlich Unbekannter: Max Bloch, ein Schüler Viktor Ullmanns. Beide begegneten mir schon als Jugendlicher, wenn ich an den Lippen des ersteren hing, wie er über letzteren erzählte. Dies verdanke ich einer glücklichen Fügung: Max Bloch war der Chef meiner Mutter, als sie nach der Kapitulation in Berlin bei den Amerikanern als Sekretärin arbeitete, in einem Dokumentationszentrum, das die Unterlagen für die Nürnberger Prozesse bereitstellte. Max Bloch war dorthin als Offizier entsandt. Aus dem Dienstverhältnis wurde eine lebenslange Freundschaft. –
Das Handwerk, das ich erwarb, war kein mechanisches; auch ging es nicht darum, Stile abzubilden. Im Gegenteil, durch Kontrapunkt, Struktur- und Formgestaltung bildete ich meinen eigenen, da ich lernte, in das „Triebleben der Klänge“ zu horchen, wie es Schoenberg nennt. Komponieren: ein zurückhörendes Reagieren, das fortspinnt, spielt oder auch bricht – wo Clichés unken und Erwartungen lauern – doch stets zu einer charakteristischen Prosodie gerinnt, die den musikalischen Gedanken faßlich macht und den Hörer mitnimmt.
Dabei mischen auch Eindrücke aus Literatur und Theater mit, von der Art, wie Gedanken sich entfalten, zu Formen finden, Peripetien schlagen.
Wohin es mich mit meiner Musiksprache getrieben hat – nennen wir es: die Dritte Wiener Schule.
Was mich auch umtreibt:
Wie Musik gespielt wird – denn das haben mir jene Schoenberg-Schüler mitgegeben. „Die Finger müssen dem Gedanken folgen“, nannte es Rudolf Kolisch. So betreibe ich mit Vorliebe Einstudierungen von Kammermusik mit Werken der Wiener Schule, der alten und der neuen.
Vortragsreihe
Instrumenten-Museum Berlin
„Die Finger müssen dem Gedanken folgen“ – Schoenberg, Berg, Webern: Wie man ihre Musik eigentlich spielen sollte. Einstudierung von Schoenbergs IV. Streichquartett, Bergs Streichquartett op.3 und Weberns Werken für Streichtrio mit dem KNM Quartett.
Gastprofessor für Komposition und Dirigieren
Escola de Música e Belas Artes do Paraná in Brasilien. Dort Gründung eines Ensembles für zeitgenössische Musik: ConTempoSonoro. Mit dem Ensemble zahlreiche Konzerte auf Einladung des Goethe-Instituts. 1997 bei der Biennale für zeitgenössische Musik in Rio de Janeiro. 1998 am Institut für Neue Musik Berlin.
Mentor für musikalische Gestaltung
I. Internationale Bühnenklasse am Bauhaus Dessau
Lehrbeauftragter für Musik und Sprache
Freie Universität Berlin
Stipendium der GEMA und der Stiftung Musikleben
Centro Tedesco, Venedig; Djerassi Foundation, San Francisco
Arnold Schoenberg Institute, Los Angeles
Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Stiftung
Villa Aurora, Los Angeles
Aus Geigen Stimmen
mit 53 Geigen, 1 Viola, 1 Cello und gemischtem Chor
für die aus der Shoa geretteten „Violins of Hope“ des Amnon Weinstein
Auftragswerk des Rundfunk Sinfonieorchesters Berlin
Uraufführung am 27. Januar 2025 in der Philharmonie Berlin
anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin und RIAS Kammerchor unter Leitung von
Vladimir Jurowski
Buch-Edition in Zusammenarbeit mit Claudia Mayer-Haase:
der Briefwechsel zwischen Arnold Schoenberg und Felix Greissle mit dessen Memoiren
Gefördert durch ein Stipendium der Ernst-von-Siemens-Stiftung
Erscheint 2025 im Wolke Verlag
„PARTITA FÜR GROSSES ORCHESTER, hochkonzentriertes Stück eines Musikers, den man der Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit seiner Arbeit wegen altmodisch einen ‘Tonsetzer’ nennen könnte. Ein Stück, bei dem erst spät klar wurde, daß es einen ‘Anlauf’, eine Einleitung brauchen würde und einen zweiten Teil nach sich ziehen werde – als eine Erfahrung, die Tuercke mit etlichen großen Musikern, in unseren Tagen mit Ligeti, aber auch mit Mahler teilt.“Peter Gülke zur Uraufführung der PARTITA FÜR GROSSES ORCHESTER (Westdeutsche Zeitung)
„Tuercke’s OCTET for winds, brass and strings: strong, abrasive music touched here and there by the ghost of Webern, but speaking throughout with his own voice as well. ... Tuercke is a find. The Kronos Quartet, among others, has taken up some of his music.“
Daily News Los Angeles
„Berthold Tuercke beschwor in seinem FINALE für drei Violinen und Klavier Endzeitliches – seine Musik setzte bewußt auf Einschnitte, die abrupt ein offenes Ende signalisierten.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Berthold Tuercke’s AUF DER GALERIE is an exquisite setting of its Kafka text. ... The instrumental framework, with jagged and slashing accents surrounded by spurts of mercurial lyricism, actually cinematizes the emotions. ... the Kronos did its blazing to high artistic effect.“
Los Angeles Times
„The four call themselves the Kronos Quartet. ... The quartet’s ... series ... contains ... the composers John Lennon, ... Philip Glass, Jan Morthenson, Terry Riley, Berthold Tuercke ... something exciting and fresh from the Kronos..”
The New York Times
„Tuercke läßt den Worten ihre tödliche Schärfe, unterlegt ihnen die Musik als Subtext -- sie ist nicht Begleitung, sondern gleichberechtigtes Ausdrucksmoment. Mitunter greift sie die verbale Komik auf ... mit lachendem Fagott ... oder in einem makabren Tango ... Stimmen und Instrumente ... verschmelzen in einem unaufhörlichen, unerbittlichen Vorwärtstreiben, in einem Zwiegespräch, das das sinnlos eifernde Geschwätz der ganzen Menschheit surrealistisch überhöht.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Kammeroper QUARTETT
„ ... Tuerckes vierteiliger Liedzyklus nach Gedichten von Paul Celan. Die Musik entriß die Poesie den neutralen Druckbuchstaben und ließ ohne falschen Zungenschlag den ohnehin in ihr verborgenen Ton herausklingen. Versteht sich, daß kompositorische Klarheit erst recht eindeutige Wiedergabe verlangte -- die von Berthold Tuercke mitgebrachten Interpreten waren ausnahmslos kompetent und standen auf einer Stufe mit den beiden klavierspielenden Komponisten.“
Hannoversche Allgemeine Zeitung
„Was hier an Vielfalt stimmlichen Ausdrucks und musikalischer Form zusammenkam, an Schönberg erinnerte und doch mehr war als nur dessen Kopie, weckte die Vermutung, daß die Schönberg-Tradition gerade jenseits der seriellen Musik voller unausgeschöpfter Möglichkeiten steckt. Die weitere kompositorische Entwicklung von ... Tuercke zu verfolgen, wäre von großem musikalischen Interesse.“
taz tageszeitung über VIER LIEDER nach Texten von Paul Celan
„Hervorragend ... gelingt es dem Berliner Komponisten Berthold Tuercke, die Klänge der ‚Glücklichen Hand’ aus den Bedingungen eines kleinen Ensembles heraus zu denken. Dabei verfährt er freier, indem bei Schönberg nicht besetzte Instrumente wie Saxofon oder Akkordeon zum Einsatz kommen; sie geben dem Klang Volumen und Schärfe.“
Die Berliner Zeitung über Schönbergs Glückliche Hand in der Bearbeitung für Kammerorchester
„Tuercke, der sich als Schüler von Lachenmann und so renommierter Schönbergianer wie Rudolf Kolisch ausgeben darf, kann eine erstaunlich komplexe und streng gefügte musikalische Sprache ins Feld führen, die aus dem Dualismus von intellektualistischer Kühle und sinnlichem Feuer ihre konstant aufreizende Wirkung bezieht."
Die Welt über die Kammeroper QUARTETT